Kunst und Kultur in der nachhaltigen Transformation von ländlichen Regionen. Zu diesem Thema habe ich am 17. Juni 2021 einen Vortrag vor dem Kulturrat Münsterland gehalten. Hier der Text…
Ich lebe seit drei Jahrzehnten in Großstädten, das Leben auf dem Land ist mir jedoch vertraut, da ich in einer ländlichen Region in Italien aufgewachsen bin. 2019 war ich Prozessbegleiter für die Region Oberes Mittelrheintal zwischen Koblenz, Bingen und Rüdesheim im Rahmen des Förderprogramms »TRAFO-Modelle für Kultur im Wandel« der Kulturstiftung des Bundes. Mit diesem Programm werden die Kunst und die Kultur in ausgewählten ländlichen Regionen gestärkt. Dabei steht die Transformation einer Kultureinrichtung im Vordergrund. Es geht um die Vernetzung der Kunst- und Kulturszene in der Region und um die Beteiligung der Bevölkerung an der Gestaltung des Kulturprogramms.
Im Oberen Mittelrheintal habe ich 16 Expert/innen interviewt und eine Studie über die Region verfasst. Einige Erkenntnisse aus dieser Studie bieten vielleicht auch für andere ländliche Regionen einen interessanten Denkanstoß.
Erstens. Für eine Transformation der Gesellschaft zur Nachhaltigkeit reicht der enge Kulturbegriff, der Kultur auf die Künste reduziert, nicht aus. Kulturpolitik als Spartenpolitik, als Lobbyarbeit für eine bestimmte Klientel, reicht nicht aus. Mindestens genauso wichtig ist die „Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik“.
Kultur findet nicht nur in den Museen und in den Theatern statt. Eine Kultur gibt es auch in den öffentlichen Verwaltungen, in den Rathäusern, in den Unternehmen, in den Massenmedien und in den Supermärkten. Vor allem diese Kultur ist für die Frage der Nachhaltigkeit besonders relevant. Vor allem diese Kultur sollte hinterfragt werden.
Kultur ist der Bauplan der Gesellschaft – und in der Entwicklung unserer Gesellschaft materialisiert sich eine Monokultur.
So zum Beispiel in der Stadtentwicklung. Die traditionelle Architektur wird überall durch die gleiche funktionalistische, sterile Architektur ersetzt, die keine Beziehung zum Territorium hat. Die Städte der Welt werden immer austauschbarer. Die heutige Stadt wird lediglich konsumiert, überall die gleichen Handelsketten. Der Einzelhandel und das Handwerk verschwinden. Die Menschen kaufen nicht mehr auf Wochenmärkten Produkte aus der Region, sondern bei REWE. Die Monokultur erfahren wir auch durch die Tatsache, dass die Investoren und die Rendite die Entwicklung der Städte mehr bestimmen als die Bevölkerung selbst. In dieser geistigen Monokultur ist Wirtschaftswachstum ein Dogma, das keine Partei infrage stellt.
Was ist so problematisch an einer Monokultur? Monokulturen sind besonders anfällig für Krisen: Was für landwirtschaftliche Monokulturen gilt, gilt genauso für ökonomische und geistige Monokulturen. Die heute dominante Monokultur führt unsere Gesellschaft in eine Sackgasse. Das zeigt sich in der Häufung von Krisen: Finanzkrise, Corona-Krise, Klimakrise…. Egal um welche Krise es geht, wir bekommen immer dieselbe Antwort darauf: „Wir brauchen noch mehr Wirtschaftswachstum und noch mehr Massenkonsum!“. Probleme kann man jedoch niemals mit derselben Denkweise lösen, mit der sie entstanden sind, hat uns Albert Einstein gelehrt.
Für Nachhaltigkeit brauchen wir Kulturkritik, die ideologische Mechanismen in unserer Gesellschaft offenlegt und angebliche Selbstverständlichkeiten hinterfragt. Gibt es wirklich keine besseren Alternativen als diese Politik, Wirtschaft und Lebensweise? Warum müssen wir immer weiterwachsen, wenn man auch miteinander teilen und gerecht umverteilen kann? Die Kunst und die Kultur können Fragen stellen, die in der Politik nicht mehr gestellt werden. Denn die Politik verkommt leider immer mehr zur Verwaltung der Alternativlosigkeit.
Nachhaltigkeit meint kulturelle Vielfalt statt Monokultur.
Dieses Prinzip wurde von der UNESCO selbst in einer Erklärung von 2001 festgehalten: Für die Nachhaltigkeit von sozialen Systemen ist die kulturelle Vielfalt genauso wichtig, wie es die Biodiversität für die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen ist. Was bedeutet das konkret für die nachhaltige Transformation von ländlichen Regionen? So wie die Waldmonokulturen durch Mischwälder ersetzt werden sollten, um der Erderwärmung standzuhalten, so brauchen wir in den Städten und in den Gemeinden mehr Räume für kulturelle Wildwuchs. Und Wildwuchs kann nur dann entstehen, wenn man nicht alles von oben plant und vorgibt. Kulturelle Vielfalt kann es nur dann geben, wenn man Freiräume für Alternativen zulässt. Kulturelle Vielfalt bedeutet manchmal auch, den Widerspruch auszuhalten.
Ein Beispiel von kulturellem Wildwuchs ist das Bürgerzentrum Schuhfabrik in Ahlen im Münsterland. Dort besetzten junge Menschen 1984 eine alte Schuhfabrik, um sie vor dem Abriss zu schützen. An ihre Stelle wollte die Stadt ein Parkhaus bauen. Diese jungen, engagierten Menschen haben das Haus nach und nach in ein soziokulturelles Zentrum umgewandelt. Die Politik und die Verwaltung haben ein paar Jahrzehnte gebraucht, um diese Kröte zu schlucken – aber heute ist die Schuhfabrik in Ahlen nicht mehr wegzudenken.
Die Schuhfabrik ist ein Ort, der das gute Leben in Ahlen fördert, denn das gute Leben ist bunt. Das gute Leben braucht mehr solche Räume, in denen sich Andersartigkeit entfalten kann. Andersartigkeit steckt nicht nur in den Migranten, sondern in jedem Künstler, in jedem von uns. Freiräume machen die Gesellschaft nicht nur lebenswerter, sondern auch nachhaltiger, weil darin oft die Zukunft vorbereitet und vorgelebt wird. Auch die Energiewende ist zuerst in den Nischen erprobt worden.
Zweitens. Die Kulturpolitik wird oft stark funktionalisiert, gerade in benachteiligten Regionen. Wenn öffentliches Geld für Kunst und Kultur ausgegeben wird, dann wird mit dem ökonomischen Nutzen argumentiert. Zum Beispiel, dass die Kunst dem Regionalmarketing dient. Die Rheinromantik ist das Aushängeschild für die Vermarktung der Produkte, zum Beispiel des Rieslings. Kunst und Kultur sind wichtig, um Touristen anzuziehen und zu unterhalten.
Für die Transformation zur Nachhaltigkeit braucht es aber keine funktionalisierte Kultur.
Nur eine besonders freie Kunst, Wissenschaft, Bildung und Presse ermöglichen eine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit außerhalb der Illusionsblasen und der Komfortzonen. Nur eine freie Wissenschaft und Kunst ermöglichen eine Kommunikation mit der äußeren und inneren Umwelt.
Während Globalisierung und Modernisierung zu einer Entwurzelung der Region führen, erfordert eine Transformation zur Nachhaltigkeit eine Wiederverwurzelung. Ländliche Regionen benötigen eine Kulturpolitik, die nicht nur nach oben (zur Hochkultur) und nach außen schaut, sondern eine Kulturpolitik der Wiederbesinnung der Region auf sich selbst, auf die eigene Besonderheit, Geschichte, Natur und Identität.
Bevor die Kulturpolitik für die Touristen ist, muss sie für die Menschen in der Region sein. Genauso brauchen wir eine Ökonomie, die die regionale Selbstversorgung vor die globale Fremdversorgung stellt, regionale Wirtschaftskreisläufe.
Die Provence in Südfrankreich macht es vor. Diese Region hat sich auf sich selbst und die eigene Identität besonnen – und ist gerade dadurch attraktiv. Künstlerinnen und Künstler kehren Großstädten wie Paris und Brüssel den Rücken, um in der Provence zu leben. Die Dörfer werden dort durch die Sanierung nicht sterilisiert, sondern behalten ihre Ursprünglichkeit. In der Provence habe ich kein Fast food gesehen: Die Menschen wollen lieber, dass das Brot nach Brot schmeckt und nach Tradition gebacken wird.
Um die Einzigartigkeit gegen den Druck der Monokultur zu schützen, braucht es Selbstbewusstsein.
Jede Identität ist aber genauso stark, wie die Vielfalt, die sich darin ausdrücken kann.
Auch in ländlichen Regionen gibt es eine unglaubliche Vielfalt, wenn man genau hinschaut. Zu oft bleiben aber die Politik, die Wirtschaft, manchmal auch die Kultur eine Veranstaltung von weißen Männern aus der Mittelschicht. Kulturelle Vielfalt heißt Augenhöhe und Vermischung statt struktureller Diskriminierung.
Drittens. Es stellt sich die Frage, wer macht die Kulturpolitik für wen; wer macht die Region für wen. Wer entwickelt die Städte und die Gemeinden für wen. Was für Künstlerinnen und Künstler gilt, gilt genauso für alle Menschen: Sie identifizieren sich viel mehr mit Dingen, die selbstgemacht sind, als mit Dingen, die vorgegeben werden.
Die Region Oberes Mittelrheintal ist von oben herab entstanden. Es waren die Institutionen, die diese Region künstlich erfunden haben, um sie als Welterbe der UNESCO anerkannt zu bekommen. An der Basis wird diese Region aber nicht gelebt, denn die Bevölkerung kann sich mit der Region nicht identifizieren. Die Politik hat die Bevölkerung nie gefragt, wie sie die Region gerne entwickeln würde oder was die Identität der Region ausmacht. Die Rheinromantik und die Burgruinen? Das ist die Hochkultur, die Kultur des Adels… und nicht die Kultur, wie sie unten gelebt wird.
Partizipation, Mitbestimmung, Mitgestaltung, gelebte Demokratie: Das ist der Schlüssel für eine Region und ein Kulturangebot, mit dem sich die Bevölkerung stark identifizieren kann.
Gerade in ländlichen Regionen ist ein erweitertes Verständnis von Kunst und Kultur nötig – jenseits der exklusiven Hochkultur. Alle Menschen machen Kunst und Kultur, nur auf ihre eigene Art und Weise. »Jeder Bürger ist ein Künstler« (J. Beuys). Im Oberen Mittelrheintal sind viele Winzer für mich Künstler, denn sie machen ihre Arbeit mit einer unglaublichen Leidenschaft. Darin steckt sehr viel Wissen und Kreativität. Ich habe für das Obere Mittelrheintal die Bildung eines Kulturparlaments vorgeschlagen, in dem meiner Meinung nach unbedingt auch Winzer vertreten sein sollten. Genauso wie das traditionelle Handwerk, die Architektur, die Esskultur, die Religionen, die Migrantenkulturen, die Subkulturen.
Für den Zusammenhalt in der Gesellschaft benötigen wir eine dritte Form von Gütern neben privaten und öffentlichen: Gemeingüter, Kollektivgüter.
Bis zur Industrialisierung und Privatisierung waren Wälder, Ackerland, Flüsse… in Europa vor allem ein Gemeingut, das der Genossenschaft ihrer Nutzer gehörte. Gemeingüter stehen zwischen Markt und Staat, sie sind weder Privateigentum noch der öffentlichen Verwaltung untergeordnet. Auch Straßen, Stadtteile, Gärten, Theater oder Museen können zum Gemeingut werden und von ihren Nutzer/innen verwaltet werden, vorausgesetzt die Institutionen lassen Selbstverwaltung zu. Eine Nachbarschaft geht mit der eigenen Straße viel pfleglicher um, wenn sie mehr Verantwortung dafür tragen darf. Wenn eine Nachbarschaft die eigene Straße stärker gestalten und selbst verwalten darf, am besten mit Unterstützung der Verwaltung, dann kommt sie fast selbst zur Nachhaltigkeit und zu einer Reduktion der Autos. Das ist meine Erfahrung.
Gemeingüter wirken sich wie ein Identifikationselement in der Vielfalt aus und stärken den Zusammenhalt. Da die Kirchen immer leerer werden, warum nicht diese in Gemeingüter umwandeln, die von der jeweiligen Nachbarschaft oder auch von Kunst und Kultur selbst eingerichtet und verwaltet werden?
Die Transformation zur Nachhaltigkeit braucht mehr Räume als Gemeingut, mehr Räume als Agora. Die Agora war der Platz inmitten der altgriechischen Polis, auf der sich die Bürger regelmäßig trafen, um die Entwicklung der eigenen Stadt zusammen zu bestimmen. Die Agora gilt als Ursprung der direkten Demokratie. Auf der Agora fand auch der Markt statt, es wurden soziale Beziehungen gepflegt. Hier fand Kunst und Kultur im öffentlichen Raum statt. Wo ist heute die Agora geblieben? Sie ist aus der Stadtplanung verschwunden, stattdessen wird der urbane Raum immer stärker privatisiert, kommerzialisiert oder durch Autos besetzt. Wenn wir eine Krise der Demokratie erleben, dann kommt das auch daher, dass es keine Agora mehr gibt oder dass diese nur dem Markt dient. Als Ersatz für die Agora reichen die virtuellen Räume der social media nicht aus, es sind realphysische Räume der Begegnung nötig – zum Beispiel soziokulturelle Zentren, nachbarschaftliche Wohnzimmer, Gemeinschaftsgärten… Auch Theater und Museen können als Agora dienen.
Während in der Coronakrise jeder gesellschaftliche Bereich nur für sich Lobbyarbeit gemacht hat, brauchen wir eine Agora, wo sich die Gesellschaft als Ganzes reflektiert und alle Bereiche gemeinsam eine Vision für die Zukunft abstimmen.
2011 hatte ich in Köln die Idee eines Tags des guten Lebens. Seit 2013 findet er jedes Jahr dort in wechselnden Stadtteilen tatsächlich statt. An diesem Tag werden die Straßen und die Plätze eines ganzen Stadtteils in eine Agora umgewandelt. 20.000 bis 30.000 Bewohner/innen dürfen dann den eigenen Veedel für einen Tag selbst regieren und das eigene Programm des guten Lebens erlebbar umsetzen. 25 bis 35 Straßen sind komplett autofrei und dienen als Freiraum für die Aktionen der Nachbarschaften. Sie dürfen alles, außer verkaufen und kaufen. Nur das Schenken und das miteinander Teilen sind erlaubt.
Der Tag des guten Lebens ist eine Spielwiese, in der selbst entwickelte Alternativen zum Alltag erlebt und gestaltet werden können. Und was erlebt wird, hat eine stärkere Überzeugungskraft, als nur über etwas zu reden. Seit dem Tag des guten Lebens wollen die Nachbarschaften weniger Autos in ihrem Quartier, mehr öffentlichen Raum als Aufenthaltsraum. Die Menschen erfahren an diesem Tag, dass Nachhaltigkeit nicht Verzicht und Fremdbestimmung bedeutet, sondern einen Gewinn an Lebensqualität und an Emanzipation. Die Menschen erfahren kollektive Selbstwirksamkeit. Sie erfahren den Veedel als ihr Eigen, als große Wohngemeinschaft. Der Tag des guten Lebens ist kein Event, kein Stadtteilfest: Der Weg ist das eigentliche Ziel. Um die Politik und die Verwaltung zu bewegen, dieser Initiative zuzustimmen, hat sich ein Bündnis von 130 Organisationen, Initiativen, Theatern, Schulen… gebildet: die Agora Köln. Alle Parteien von Links nach Rechts haben dann dem Tag des guten Lebens zugestimmt, und das bisher in drei Stadtbezirken.
Durch den Erfolg hat die Verwaltung feststellen müssen, dass nicht mehr Chaos entsteht, wenn man mehr Verantwortung auf die Bürger/innen überträgt und sie einfach machen lässt. Es lohnt sich, den Bürger/innen mehr Vertrauen zu schenken. Für die Transformation brauchen wir breite, unkonventionelle Bündnisse – und dies bedeutet auch Public-Citizen-Partnerships anstelle von Public-Private-Partnerships.
Der Zusammenhalt in den Gemeinden und in den Regionen benötigt nichtkommerzielle, inklusive Rituale, in denen Menschen Kultur selbst machen und nicht nur konsumieren – und der Tag des guten Lebens ist ein Beispiel dafür.
Im Oberen Mittelrheintal habe ich vorgeschlagen, dass jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine regionale Kulturhauptstadt ausgezeichnet wird, so ähnlich wie die Europäische Kulturhauptstadt. Durch eine regionale Kulturhauptstadt, die ständig wechselt, könnte die Vernetzung der Kunst und Kultur in der Region gestärkt – und diese sichtbarer gemacht werden.
Viertens. Gerade in ländlichen Regionen sollten wir Kultur und Natur nicht als Gegensätze verstehen, sondern als Verbündete. Gerade in ländlichen Regionen haben sich Kultur und Natur historisch zu einem nachhaltigen Gleichgewicht entwickelt. Das erkennt man in der traditionellen Esskultur, genauso wie in der traditionellen Architektur. Meine Großeltern in Italien waren Bauern. Mein Großvater hat nie studiert, er wusste nicht einmal was Nachhaltigkeit bedeutet, trotzdem war eine Landwirtschaft ohne Chemie für ihn das Normalste überhaupt.
Nachhaltigkeit ist nicht nur Zukunft und Innovation, sondern auch eine Vielfalt an traditionellem Wissen, das wieder entdeckt und aufgewertet werden sollte.
Dinge reparieren und aufwerten, statt wegzuwerfen, das war in meiner Kindheit normal. Die Leute haben damals nicht viel Geld gehabt, aber sie haben in der Nachbarschaft viel miteinander geteilt. Für Nachhaltigkeit brauchen wir nicht unbedingt mehr Geld – Sozialkapital ist mindestens genauso wichtig. Nachhaltigkeit braucht mehr Gemeinwesen statt Privatwesen.
Warum habe ich die ländliche Region trotzdem verlassen? Weil diese Form von Dorfgemeinschaft eine starke Kontrolle auf ihre Individuen ausgeübt hat. Man konnte sich nicht entfalten. Man konnte nur dann Solidarität erfahren, wenn man sich an ungeschriebene Regeln hielt. Sobald man anders war, wurde man schnell ausgeschlossen. Deshalb ist der Tag des guten Lebens für mich auch ein Reallabor zu der Frage, wie weltoffene Gemeinschaft gehen kann – wie Individualität und Gemeinschaft, Freiheit und Verantwortung, Kunst und Politik zusammengehen können, ohne sich gegenseitig zu vernichten. Wir brauchen Reallabore und Spielwiesen, um Beziehung und Kooperation in der Vielfalt zu lernen, auf jeden Fall braucht es Toleranz und Augenhöhe.
Nachhaltigkeit meint einerseits das gute Leben, eine Chance. Andererseits stellt sie die Frage, wie wir mit Krisen umgehen, die unsere Existenz gefährden. Also eine Notwendigkeit.
Zum guten Leben. Die Kunst und Kultureinrichtungen können selbst eine Agora bieten, in denen gemeinsam das gute Leben zur Debatte steht und gemeinsam angegangen wird, denn schon in einer Nachbarschaft gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen davon. Wie kommen sie zu einer gemeinsamen?
In unserer Gesellschaft wird Wohlstand mit Wirtschaftswachstum und Massenkonsum gleichgesetzt. Es herrscht die Idee, dass es allen Menschen besser geht, wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt. Die Erfahrung zeigt, dass das nicht stimmt: Unser Wohlstand ist oft ein Wohlstand auf Kosten anderer, künftiger Generationen inbegriffen.
Wir können nur deshalb von Wachstum reden, weil viele Kosten externalisiert und in der Rechnung nicht berücksichtigt werden. Diese Kosten sind ökologische, aber auch soziale. Sie werden unter anderem am Mittelmeer sichtbar, wenn dort Menschen ertrinken, weil sie vor einem Elend fliehen, das seine Ursache auch bei uns hat. Denn unser Massenkonsum basiert auf Ausbeutung.
Es gibt kein gutes Leben auf Kosten anderer.
Gutes Leben ist ein Dachbegriff für alternative Wohlstandsmodelle jenseits von Wirtschaftswachstum und Massenkonsum. Es geht um ein multidimensionales Verständnis von Wohlstand, das neben ökonomischen, auch soziale, ökologische und kulturelle Aspekte berücksichtigt. Was das gute Leben ist, das muss nicht unbedingt neu erfunden werden, wir können auch von anderen Kulturen und Subkulturen lernen. In der Rangliste der Länder, in denen das Wohlbefinden der Menschen am höchsten ist, stehen die skandinavischen Länder ganz oben. Was machen sie besser? Für das Wohlbefinden der Menschen ist eine soziale Grundsicherung viel wichtiger, als die Freiheit Privatvermögen zu vermehren. In Skandinavien sind die Systeme der sozialen Grundsicherung besonders stark, so dass kein Mensch dort Angst haben muss, nach unten zu fallen. Davon profitieren auch Künstler/innen. Für dieses System zahlen die Menschen dann auch gerne mehr Steuern. Auch eine Atmosphäre der Großzügigkeit macht Menschen glücklicher. Die Menschen sind glücklicher und gesunder, da wo soziale Ungleichheiten weniger ausgeprägt sind.
Nachhaltigkeit als Notwendigkeit. Die deutsche Bundesregierung hat gerade beschlossen, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden soll. Das heißt, alle Treibhausemissionen sollen innerhalb von 25 Jahren auf Null gesenkt werden. Hier geht es nicht einfach um mehr Elektroautos und um mehr Windräder: Es geht um einen Systemwechsel. Es geht um eine radikale Veränderung der Wirtschaft, der Lebensweise und der Gesellschaft in den nächsten 25 Jahren. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) hat 2011 diese Transformation mit der Industriellen Revolution verglichen, um ihre Größenordnung bewusst zu machen – eine umfassende Revolution in 25 Jahren. Kann das die Kunst und die Kultur unberührt lassen?
Die Frage ist nicht, ob wir diese radikale Transformation wollen oder nicht. Wir sind wahrscheinlich schon mittendrin. Die einzige Frage ist, ob diese Transformation by disaster or by design stattfinden wird.
In einer Transformation, die von uns gestaltet wird, können die Kunst und die Kultur eine Avantgarde sein. Sie können den Möglichkeitsraum, das Reallabor für die ganze Gesellschaft sein, um die Transformation zu lernen.
Jeder kann mit der Transformation zum guten Leben und zur Nachhaltigkeit vor der eigenen Haustür beginnen. Dafür müssen wir nicht auf die Bundesregierung warten. Die Kunst und Kultur können eine kollektive Selbstermächtigung fördern.
© Köln, 17.06.2021 – Davide Brocchi
Dokumente
Bild: Website Münsterland. DAS GUTE LEBEN Fachlektorat: Annette Schwindt









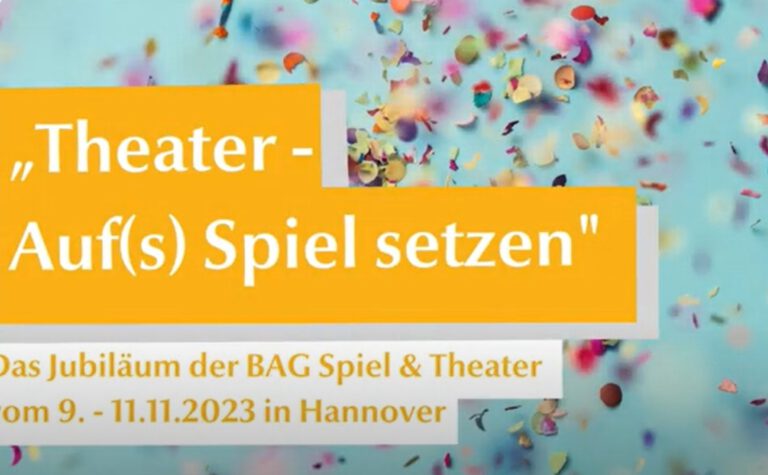
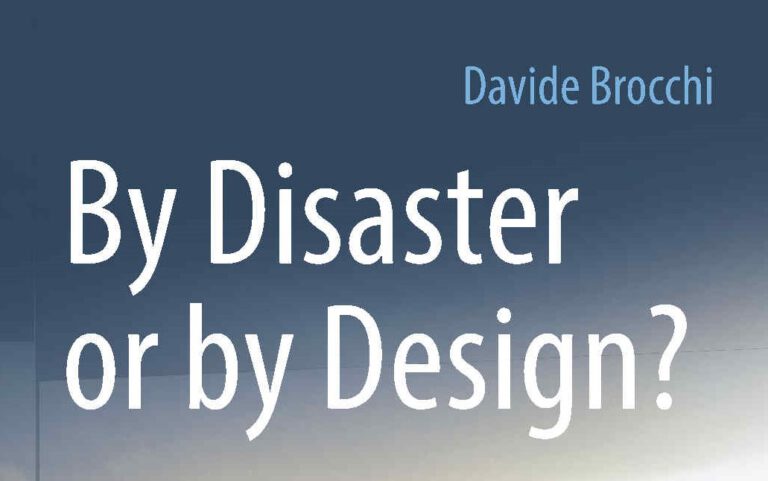


Neueste Kommentare